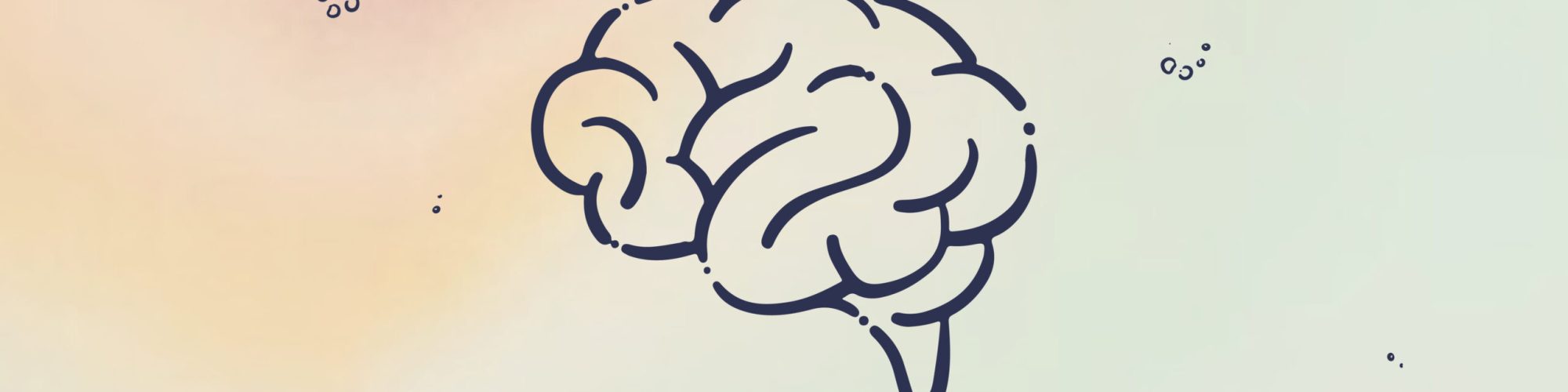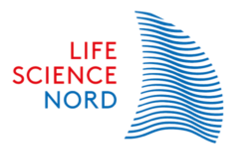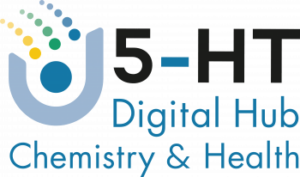So durchbrichst Du den Angst-Schmerz-Zyklus
Viele Menschen mit chronischen Schmerzen kennen es: Schon der Gedanke an eine bestimmte Bewegung, einen bevorstehenden Arbeitstag oder eine körperliche Belastung kann Angst auslösen – aus Furcht vor stärkerem Schmerz. Genau diese Angst kann den Schmerz jedoch verstärken. Dieses Zusammenspiel wird als Angst-Schmerz-Zyklus bezeichnet – aber er ist veränderbar.
Was ist der Angst-Schmerz-Zyklus?
Schmerz ist in erster Linie ein Schutzsignal. Bei einer Verletzung sorgt er dafür, dass Bewegungen vorsichtiger erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden. Doch wenn dieser Schutzmechanismus „hängen bleibt“, kann er zum Problem werden.
Das fear-avoidance model of pain nach Vlaeyen und Linton beschreibt diesen Teufelskreis:
- Schmerz löst Angst aus – Befürchtung, dass er schlimmer wird oder etwas „kaputt gehen“ könnte.
- Hypervigilanz – übermäßige Aufmerksamkeit auf den Schmerz, verstärkte Wahrnehmung jedes Signals.
- Schonung und Vermeidung – Einschränkung von Bewegung oder Aktivität aus Angst vor Schmerzen.
- Verstärkung des Schmerzes – Bewegungsmangel, Anspannung und ständige Bedrohungswahrnehmung halten das Schmerzsignal aktiv.
Mit der Zeit kann so aus einem akuten Problem ein chronischer Zustand werden – selbst ohne anhaltende Gewebeschädigung.
Wie das Gehirn Angst und Schmerz verknüpft
Neurobiologische Studien zeigen: Angst aktiviert das Salienznetzwerk im Gehirn. Dieses bewertet Reize nach Wichtigkeit und potenzieller Bedrohung. Wird eine Situation als gefährlich eingestuft, erzeugt oder verstärkt das Gehirn den Schmerz als Warnsignal.
Bei chronischen Schmerzen kann dieses Netzwerk überempfindlich werden und den Schmerz dauerhaft senden. Angst wirkt dabei wie ein Verstärker – und kann chronische Schmerzen im Alltag spürbar intensivieren.
Warum Angst chronischen Schmerz verstärken kann
- Erhöhte Muskelanspannung sendet Signale an das Gehirn, die bei bestehender zentraler Sensitivierung als Gefahr interpretiert werden können.
- Dauerstress verändert die Schmerzwahrnehmung über Hormone und Neurotransmitter und hält das Alarmsystem in ständiger Bereitschaft.
- Negative Erwartungen und erlernte Schmerzassoziationen verstärken prädiktive Kodierungen (Prozesse) im Gehirn: Wenn der Organismus „mit Schmerz rechnet“, steigt die Wahrscheinlichkeit, ihn auch zu empfinden.
- Konditionierungen (z. B. Schmerz nach bestimmter Bewegung) können dazu führen, dass schon der Kontext oder die Gedanken daran ausreichen, um das Schmerznetzwerk zu aktivieren.
Wege aus dem Angst-Schmerz-Zyklus
Das Angstsystem muss beruhigt und Sicherheit neu gelernt werden. In HELP kommen dazu verschiedene wissenschaftlich fundierte Methoden zum Einsatz, zum Beispiel:
- Somatic Tracking – achtsame, nicht wertende Beobachtung von Empfindungen, um „Sicherheit statt Gefahr“ zu signalisieren.
- Affirmationen – positive Botschaften, die das Vertrauen in den Körper stärken.
- Graded Exposure – schrittweise, geplante Wiederaufnahme von Aktivitäten, um Angstreaktionen zu reduzieren und neue, schmerzfreie Erfahrungen zu verankern.
Diese Techniken können ihre volle Wirkung erst entfalten, wenn klar ist: Der Körper ist nicht kaputt. Erst dann kann das Gehirn die notwendige Sicherheit verankern. Deshalb startet die Reise mit HELP mit ausführlicher Schmerzedukation und der Möglichkeit, das eigene Schmerzsignal aus einer veränderten Perspektive zu betrachten und neu einzuordnen – oft als noziplastisches Schmerzsignal.
Fazit
Angst und Schmerz sind eng verknüpft – doch diese Verbindung lässt sich lösen. Wer die Mechanismen versteht und gezielt beeinflusst, kann den Angst-Schmerz-Zyklus durchbrechen. Das erfordert Zeit, Übung und die Bereitschaft, neue Erfahrungen zuzulassen.
In HELP findest Du eine detaillierte Anleitung, um den Angst-Schmerz-Zyklus zu verstehen, Sicherheit zurückzugewinnen und neue, schmerzfreie Erfahrungen zu machen – wissenschaftlich fundiert, alltagsnah und jederzeit in Deinem Tempo.
→ Jetzt mehr über HELP erfahren
Literatur
- Vlaeyen, J.W.S., & Linton, S.J. (2000). Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain, 85(3), 317–332.
- Meulders, A. (2020). Fear in the context of pain: Lessons learned from 100 years of fear conditioning research. Behaviour Research and Therapy, 131, 103635.
- Pinto, A.M., et al. (2023). Emotion regulation and the salience network: a hypothetical integrative model of fibromyalgia. Nature Reviews Rheumatology, 19, 44–60.

Dr. Antje Kallweit
– Gründerin und CEO von HELP, Fachärztin für Anästhesiologie, Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie
Chronische Schmerzen verlernen mit HELP – Hol Dir jetzt die App

- registriertes Medizinprodukt (CE)
- Ratenzahlung über Klarna möglich
- Schritt für Schritt zur App
- in D und A erhältlich